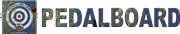Kurz zur Geschichte der Effekte
 Ein Blick zurück führt uns in die späten 40er- und frühen 50er-Jahre. Eines der ersten bekannten Effektgeräte war das Trem Trol 800 von DeArmond, ein Tremolo, das bereits 1948 auf den Markt kam – mechanisch, abgefahren und seiner Zeit weit voraus. Das Prinzip dahinter ist fast schon bizarr, aber genial: Ein kleiner Motor bewegt eine Art Wippe, die ein Röhrchen mit leitfähiger Flüssigkeit hin- und herschwenkt. Zwei Drähte tauchen dabei in die Flüssigkeit ein und aus – ist der Kontakt gegeben, hört man das Gitarrensignal, fehlt er, ist es weg. Das ergibt eine weiche, pulsierende Modulation, die sich überraschend natürlich anhört. Für damalige Verhältnisse war das ziemlich verrückt – und ziemlich cool.
Ein Blick zurück führt uns in die späten 40er- und frühen 50er-Jahre. Eines der ersten bekannten Effektgeräte war das Trem Trol 800 von DeArmond, ein Tremolo, das bereits 1948 auf den Markt kam – mechanisch, abgefahren und seiner Zeit weit voraus. Das Prinzip dahinter ist fast schon bizarr, aber genial: Ein kleiner Motor bewegt eine Art Wippe, die ein Röhrchen mit leitfähiger Flüssigkeit hin- und herschwenkt. Zwei Drähte tauchen dabei in die Flüssigkeit ein und aus – ist der Kontakt gegeben, hört man das Gitarrensignal, fehlt er, ist es weg. Das ergibt eine weiche, pulsierende Modulation, die sich überraschend natürlich anhört. Für damalige Verhältnisse war das ziemlich verrückt – und ziemlich cool.In den Folgejahren wanderten die ersten Effekte direkt in die Verstärker. Besonders Tremolo, Vibrato und der berühmte Federhall (Reverb) wurden in den 50ern gerne direkt in Amps verbaut. Die Tremolo-Schaltung arbeitete oft mit einer Kombination aus Fotozelle und LED – ein System, das übrigens auch heute noch in modernen Pedalen wie dem Fulltone SupaTrem oder dem Voodoo Lab Tremolo zum Einsatz kommt. Die LED pulsiert im Rhythmus des Effekts, der Fotowiderstand reagiert auf das Licht und verändert so das Signal. Eine andere Variante war das sogenannte Bias-Tremolo, bei dem die Endstufenröhren moduliert wurden – das sorgt für einen etwas anderen, oft wärmeren Klangcharakter.
Gegen Ende der 50er wurde es dann besonders spannend für alle, die auf Echo stehen. Neben einem Lautstärkepedal – ebenfalls von DeArmond – tauchte das erste richtige Bandecho auf: das WEM Copicat aus Großbritannien. Dieses röhrenbetriebene Gerät ahmte den Klang zweier zeitversetzt laufender Tonbandmaschinen nach. Was im Studio begann, wurde mit dem Copicat bühnentauglich – ein echter Meilenstein. Noch heute gibt es Versionen dieses Klassikers, mittlerweile auf Transistorbasis. Gitarristen der ersten Stunde, wie The Shadows, nutzten das Copicat, um ihren charakteristischen Sound zu formen.
Fast zur gleichen Zeit entwickelte sich in Italien ein anderes Delay-System, das bald Legendenstatus erlangen sollte: das Binson Echorec. Im Gegensatz zum klassischen Bandecho arbeitete es nicht mit einer Bandschleife, sondern mit einer magnetisierten Metallscheibe – ein völlig anderer Ansatz, der für eine besondere Klangtextur sorgte. Kein Wunder, dass Pink Floyd – allen voran David Gilmour – das Echorec auf unzähligen Tracks einsetzten. Der Klang dieses Geräts ist bis heute unverwechselbar und hat seinen festen Platz in der Effektgeschichte.
Das klassische Effektpedal
Doch das, was wir als klassisches "Effektpedal" beschreiben, also ein eigenständiges Gerät, welches zwischen Gitarre und Verstärker geschaltet wurde, war damals noch ein Novum und kam in den 1960er Jahren mit einem auch heute noch sehr beliebten Effekt an den Start.Das erste kommerzielle Effektpedal war der Maestro Fuzz-Tone FZ-1, entwickelt von Glenn Snoddy und veröffentlicht 1962 durch Gibson. Dieses Pedal lieferte einen aggressiven, sägenden Klang – weit entfernt vom klaren, warmen Ton, den man bisher gewohnt war. Interessanterweise blieb der Fuzz-Tone zunächst ein Ladenhüter, bis Keith Richards ihn 1965 im Song „(I Can’t Get No) Satisfaction“ einsetzte. Der Hit sorgte für einen Boom, der das Pedal über Nacht berühmt machte.
Die Technik hinter diesen frühen Pedalen war für heutige Verhältnisse überschaubar. Germanium-Transistoren bildeten das Herzstück der Schaltungen. Sie lieferten einen weichen, harmonischen Verzerrungsklang, waren allerdings auch launisch – bei Temperaturschwankungen veränderten sich ihre elektrischen Eigenschaften, was zu ungewollten Klangabweichungen führen konnte. Trotzdem war Germanium die erste Wahl, da Siliziumtransistoren zu dieser Zeit noch nicht weit verbreitet waren. Neben Transistoren kamen einfache Bauteile wie Widerstände, Kondensatoren und Dioden zum Einsatz. Die Schaltungen waren oft auf handgelöteten Lochrasterplatinen aufgebaut, teilweise sogar auf Pertinax-Platten – ein Material, das heute fast schon Kultstatus besitzt.
Im Vergleich zu modernen Preisen erschienen die frühen Effektgeräte durchaus erschwinglich: Der FZ-1 kostete seinerzeit rund 40 bis 50 US-Dollar. Rechnet man die Inflation mit ein, entspräche das heute etwa 350 bis 450 Euro. Für viele Musiker jener Zeit war das dennoch eine kleine Investition – schließlich war es ein völlig neues Konzept, in ein Gerät zu investieren, das den Klang absichtlich „beschädigte“.
Nach dem Fuzz-Tone öffnete sich die Effektwelt in alle Richtungen. Es dauerte nicht lange, bis weitere Hersteller auf den Zug sprangen. Besonders hervorzuheben ist Electro-Harmonix, gegründet 1968 von Mike Matthews, der mit dem Big Muff Pi einen Klassiker schuf, der bis heute in diversen Versionen produziert wird. Auch Dallas Arbiter aus England brachte mit dem Fuzz Face ein Gerät auf den Markt, das durch Jimi Hendrix zur Legende wurde. Parallel dazu erschienen Wah-Wah-Pedale (wie das Cry Baby), Phaser, Flanger, Reverbs und später auch die ersten Analog-Delays. Marken wie MXR, Ibanez, BOSS und DOD kamen hinzu und entwickelten Effektpedale nicht nur klanglich, sondern auch ergonomisch weiter.
Die Liste der Musiker, die in den 60er- und 70er-Jahren Effektgeräte einsetzten, liest sich wie das "Who is Who" der Gitarrengeschichte: Jimi Hendrix experimentierte unermüdlich mit Fuzz, Wah und Univibe. Eric Clapton nutzte frühe Overdrives und Boosts, um seinen Amp in die gewünschte Sättigung zu treiben. David Gilmour schichtete mit Delays und Reverbs himmlische Klangwelten aufeinander, während Tony Iommi mit Fuzz und Wah einen düsteren Signature-Sound erschuf, der später den Grundstein für Metal legte.
Heute sind originale Effektpedale aus dieser Ära begehrte Sammlerstücke. Ein gut erhaltener Fuzz-Tone oder ein Fuzz Face mit Germanium-Transistoren kann leicht vierstellige Beträge erzielen. Raritäten wie der legendäre Klon Centaur, der in den 1990er-Jahren erschien, aber auf frühen Boutique-Ideen basiert, werden mittlerweile für mehrere tausend Euro gehandelt – teils aus klanglichen, teils aus kultischen Gründen. Der Markt für Vintage-Pedale boomt. Gerade bei Puristen gelten originale Bauteile, „Mojo“ und Patina als Qualitätsmerkmale, die sich klanglich in jeder Note widerspiegeln sollen.
Seit den Anfängen hat sich die Effektwelt dramatisch verändert. Was einst mit einem simplen Fuzz begann, ist heute eine unüberschaubare Landschaft aus digitalen, analogen, hybriden und softwarebasierten Effekten. Moderne Multieffektgeräte bieten hunderte von Simulationen, speicherbare Presets, MIDI-Steuerung und USB-Anbindung. Gleichzeitig erlebt die Boutique-Szene einen Boom, bei dem kleine Hersteller mit viel Liebe zum Detail handgelötete Pedale auf den Markt bringen. Vom minimalistisch analogen Overdrive bis hin zum granularen Delay mit komplexen Modulationsoptionen ist heute alles möglich. Gitarristen haben mehr Auswahl als je zuvor – und damit auch mehr Verantwortung, ihren Sound gezielt zu gestalten.
Trotz aller technischen Fortschritte bleibt das Effektpedal ein Symbol für Kreativität, Individualität und Klangforschung. Es steht für den Moment, in dem ein Gitarrist entscheidet, seinen Ton nicht einfach hinzunehmen, sondern ihn aktiv zu formen. Und genau das macht die Magie dieser kleinen Kästchen bis heute ungebrochen.